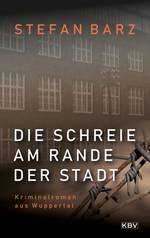
Der Remscheider Stefan Barz hat in Bonn Germanistik und Philosophie studiert und wurde nach dem Studium Lehrer. Die Liebe zum Schreiben ist geblieben – er begann mit dem Schreiben fiktionaler Texte.
2014 wurde er mit seinem Kurzkrimi „Erbsünde“ für den Agatha-Christie-Krimipreis nominiert. Sein Depütroman „Schandpfahl“ erschien im selben Jahr. Für dieses Werk wurde ihm der „Jacques-Berndorf-Förderpreis“ verliehen. Stefan Barz veröffentlichte später eine Eifel-Krimi-Reihe rund um den Kommissar Jan Grimberg.
Das Interview zu „Die Schreie am Rande der Stadt“ wurde vom KBV-Verlag durchgeführt.
Stefan Barz und sein erster bergischer Krimi
„Die Schreie am Rand der Stadt“
Nach drei Eifel-Krimis rund um den Ermittler Jan Grimberg hat es Sie nun thematisch ins Bergische Land
verschlagen, wo Sie auch als Lehrer tätig sind. Ihr erster bergischer Krimi spielt in Wuppertal und weckt
Erinnerungen an ein dunkles Kapitel deutscher Geschichte. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, die alte
Putzwollfabrik in Wuppertal-Kemna, in der ein frühes KZ der Nazis eingerichtet war, mit in den Plot
einzubinden?
Barz: Zunächst hatte ich die Idee, über einen Mord im Nationalsozialismus zu schreiben. Und weil ich seit über zehn
Jahren in Wuppertal wohne und bisher nur Eifelkrimis geschrieben habe, wollte ich außerdem mal einen bergischen
Krimi schreiben. Also habe ich angefangen, mich mit dem historischen Wuppertal in der Zeit des Nationalsozialismus
zu beschäftigen, und dann stößt man eigentlich zwangsläufig auf das KZ Kemna, das sich tief in das historische
Gedächtnis Wuppertals eingebrannt hat.
Ich habe dann die Erfahrungsberichte von Karl Ibach und Willi Weiler gelesen, die 1933 als junge Männer in diesem
KZ misshandelt wurden. Dabei wurde mir nochmal vor Augen geführt, dass die Nationalsozialisten wirklich schon
sehr früh, nur ein halbes Jahr nach Hitlers Machtergreifung, eine solche Folterhölle geschaffen haben – und das direkt
am Stadtrand! Die Menschen, die im Ortsteil Kemna wohnten, haben unmittelbar mitbekommen, welche
Grausamkeiten in diesem KZ vor sich gingen, sie haben die Schreie der Menschen gehört, und sie konnten – oder
wollten – nichts dagegen tun. Das wollte ich unbedingt in der Geschichte mitverarbeiten. Als meine Protagonisten
dieses Lager entdecken, wird ihnen endgültig bewusst, welche Terrorherrschaft in Deutschland begonnen hat, und
eine Hauptfigur sagt visionär: „Sie planen Schreckliches!“
Das in einem Kriminalroman zu verarbeiten, war aber kein leichtes Unterfangen, denn die Geschichte des KZ Kemna
ist zu ernst, um Kemna einfach nur als Kulisse für einen klassischen Krimi zu benutzen. Deshalb ist mein neuer
Roman ein ungewöhnlicher Krimi geworden: Die Krimihandlung bildet den Rahmen, um eigentlich die Geschichte des
KZ Kemna zu erzählen.
Gibt es in Ihrem Roman auch einen Ermittler, der für eine Serie taugt? Oder wer ist die zentrale Figur?
Barz: „Die Schreie am Rande der Stadt“ ist kein klassischer Ermittlerkrimi. Es gibt keinen Kommissar und auch
keinen Privatdetektiv. Die Rolle des Ermittlers übernimmt im Roman der Journalist Martin Tesche, der im Jahr 1993
den Hinweis findet, dass sein verstorbener Vater vor 60 Jahren in einem Mord verwickelt war, ohne dass sofort klar
wird, ob sein Vater tatsächlich auch der Mörder war. Martin will nun unbedingt wissen, was damals passiert ist, und er
will sich auch vergewissern, dass sein so perfekter Vater kein Mörder war. Deshalb begibt er sich auf Spurensuche.
Die eigentlichen Hauptfiguren sind aber Johannes, Henri, Georg, Friedrich und Gerda – eine Freundesclique, die
1933 den politischen Umbruch erlebt und versucht, sich der totalen Vereinnahmung aller Lebensbereiche durch den
NS-Staat zu entziehen. Allerdings ist die Handlung dieses Romans in sich abgeschlossen und eignet sich nicht für
eine Serie.
In ihrem Roman, der ja nicht dem klassischen Klischee eines Regionalkrimis mit seichter Unterhaltung
entspricht, sind Aufzeichnungen aus einem alten Tagebuch, in dem Hinweise auf einen Mord fixiert sind,
Anlass für eine Spurensuche. Sie sind nicht nur ein Fan von geschichtsträchtigen Orten, was Sie bereits mit
ihrer Eifel-Krimi-Reihe bewiesen haben, sondern auch von Tagebüchern, wie es scheint.
Barz: Die geschichtsträchtigen Orte in meinen Eifelkrimis sind deswegen interessant, weil sie ganz konkrete
Schauplätze sind, die der Leser oder die Leserin vielleicht schon kennt oder kennenlernen kann. So beginnt mein
Eifelkrimi „Spiel des Bösen“ nicht in irgendeinem unbestimmten Wald irgendwo bei Mechernich, sondern ganz
konkret an der Kakushöhle in Dreimühlen, und das wirft ja beim Lesen schon die Frage auf, ob dieser
sagenumwobene Ort als Tatort auch eine symbolische Bedeutung haben kann. Auch mein Debüt „Schandpfahl“
beginnt an einem historischen Ort, nämlich an der Gerichtssäule im Kommerner Freilichtmuseum, und offenbar will
der Täter, der hier sein Unwesen treibt, mit diesem Schauplatz ein Zeichen geben. Auch Tagebücher haben ihren
Reiz für eine Krimihandlung: Sie geben tiefe Einblicke in die Psyche eines Menschen und sie erzählen ganz intime
Geschichte, vielleicht aber auch nur verschlüsselt, denn sie sind ja eigentlich nicht für fremde Leser geschrieben,
sondern allein für den Tagebuchschreiber selbst. Daher kann der Verfasser in Tagebüchern alles loswerden, was ihn
belastet – oder er schreibt Gedankenströme hinein, die nur er als Schreiber versteht. In beiden Fällen jedenfalls geht
der Verfasser von Tagebüchern in der Regel davon aus, dass nie jemand anderes diese Aufzeichnungen zu lesen
bekommt. Und wenn die Tagebücher dann doch einem anderen Menschen in die Hände fallen, geben
unverständliche Aussagen Rätsel auf.
Obwohl die Rahmenhandlung fiktiv ist, lassen Sie den Leser in Wuppertaler Geschichte eintauchen. Nicht
nur der Mord liegt in der Vergangenheit, sondern auch der Plot rund um den Protagonisten und Journalisten
Martin Tesche, der sich auf Spurensuche in der Nazi-Zeit macht. Diese spielt im Jahr 1993. Warum 1993 und
nicht jetzt? Was verbinden Sie persönlich mit dem Jahr 1993? Damals gab es ja zum Beispiel noch keine
Handys für jedermann.
Barz: Ich habe das Jahr 1993 für die zweite Handlungsebene aus verschiedenen Gründen gewählt: Zum einen
muss der Protagonist Martin Tesche 60 Jahre, nachdem ein Mord geschehen ist, auf Zeitzeugen treffen, die damals
junge Erwachsene waren und nun noch leben. Das wäre im Jahr 2021 schwierig geworden. Dann ergab sich aber
auch eine interessante Parallele zwischen 1933 und 1993 – dem Jahr, in dem es den furchtbaren Brandanschlag im
Bergischen Land, in Solingen, gab, der von Rechtsradikalen verübt wurde und mehrere Todesopfer forderte. Dieses Thema greife ich in der 1993er-Handlung auch auf, um zu zeigen, dass die nationalsozialistische Vergangenheit auch
im Rechtsradikalismus von 1993 noch nachwirkt. Und für mich persönlich ist 1993 das Jahr, in dem ich 18 wurde und
etwa so alt war wie die Protagonisten aus der Handlungsebene von 1933. Ungefähr zu dieser Zeit habe ich selbst
auch angefangen, als freier Journalist zu arbeiten und musste, wie auch meine Figur Martin Tesche, ohne Internet
und Smartphone recherchieren.
Nach dem Krimi ist bekanntlich vor dem Krimi. Gibt es schon neue Ideen für bergische Krimis?
Barz: Das Bergische Land hat viele reizvolle Orte, die sich für eine Krimihandlung eignen – es wird bestimmt noch
weitere Krimis aus dem Bergischen geben. Eine Idee habe ich schon, aber die muss noch weiterentwickelt werden.
Außerdem weiß ich noch nicht, ob ich Jan Grimberg, den Ermittler meiner Eifelkrimis, dafür ins Bergische Land
versetzen lassen will oder einen neuen Ermittler erschaffen möchte. Jan Grimberg wird aber auf jeden Fall auch
weiter ermitteln, egal, ob in der Eifel oder im Bergischen.
Herzlichen Dank für das Interview. Das Interview erschien im Oktober 2021 und wurde vom KBV-Verlag geführt.
Weitere Informationen zum Buch und zum Autor finden Sie auf den Seiten des KBV-Verlags.
